 |
Kann man unter einem Angriff abtauchen? |
|---|
|
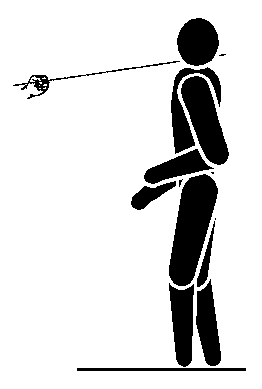 Immer wieder wird dem Kämpfer empfohlen, unter
einem Faustangriff einfach abzutauchen. Die Schwierigkeit besteht allerdings
darin, daß die Schwerkraft der einzige Antrieb ist, um nach unten
wegzutauchen, sonst besteht keine Möglichkeit, sich aktiv nach unten
zu ziehen.
Immer wieder wird dem Kämpfer empfohlen, unter
einem Faustangriff einfach abzutauchen. Die Schwierigkeit besteht allerdings
darin, daß die Schwerkraft der einzige Antrieb ist, um nach unten
wegzutauchen, sonst besteht keine Möglichkeit, sich aktiv nach unten
zu ziehen.
Doch das geht nicht beliebig schnell. Die Person im Bild soll unter einem Faustangriff abtauchen. Die Faust zielt auf das Kinn der Person. Im gleichen Augenblick, in dem die Faust mit der Bewegung beginnt, reagiert die Person bereits und taucht ab. Wie lange dauert es, bis sie so weit gefallen ist, daß die Faust über den Kopf hinwegschlägt?
Nach DIN 33402 liegen bei über 90 % der Bevölkerung die Kopfhöhen zwischen 195…244 mm, d.h. so weit muß der Kopf fallen. Die Faust muß sich also zwischen 0,2…0,22 s Zeit lassen, wenn sie nicht treffen will. Dabei handelt es sich um eine physikalisch notwendige Minimalzeit. Eine ansatzlos geschlagene Faust trifft aber schon nach 0,15…0,2 s. Dazu kommt, daß das Opfer noch eine Reaktionszeit braucht, um auf den Faustangriff zu reagieren.
Normalerweise fallen alle Körper gleich schnell (das hatte bereits Galileo Galilei nach ausführlichen Fallversuchen vermutet), sofern nicht der Luftwiderstand bremst (spielt im Kampfsport keine Rolle). Die Kurve in Bild 32 gilt daher unabhängig vom Gewicht oder der Körperhaltung der fallenden Person.
Dieser Beobachtung scheint es zu widersprechen, daß man die Hand schneller bewegen kann. So ist es z.B. möglich, eine Orange fallen zu lassen und sie mit der Hand aufzufangen. Der Grund liegt darin, daß sich der Arm im Schultergelenk am restlichen, schweren Körper abstützt und sich so nach unten drücken kann.
Sicherlich wird niemand ernsthaft das Abtauchen des gesamten Körpers trainieren. Oft sieht man jedoch ein Abtauchen und Ausweichen mit dem Oberkörper. Der Kämpfer geht dabei zur Seite und dann nach unten weg. Das geht schneller, weil ein Teil des Körpers (die Beine) stehen bleibt und der Rest des Körpers dafür um so schneller fällt. Grundregel der Physik ist, daß der Gesamtschwerpunkt immer gleich schnell fällt. In den Beinen sind etwa 38 % (0,38) der Körpermasse konzentriert , daher könnten sich die übrigen 62 % (0,62) der Körpermasse mit Hilfe einer trainierten Muskulatur etwa 61 % (1/0,62-1) schneller zu Boden bewegen, als es die Fallgeschwindigkeit erlaubt. Der Gesamtschwerpunkt fällt immer noch in Normalgeschwindigkeit, aber der Teilschwerpunkt der Beine bleibt auf gleicher Höhe und der Teilschwerpunkt des Oberkörpers fällt entsprechend schneller.
Der Erfolg des Abtauchens wird sehr vom Regelwerk bestimmt:
|
In Filmen der Kategorie ‘Eastern’ springen die kampfkunsterfahrenen Helden oft von der Straße auf’s Dach oder auf Bäume. Im Film geht das ganz einfach: Man dreht die Szene Rückwärts.
Im richtigen Leben sieht das alles wieder ganz anders aus, wie man aus der Betrachtung eines Hochspringers auf dem Mond erkennt, wo die Anziehungskraft nur 1/6 der Erdanziehung beträgt. Man könnte nun auf den Gedanken kommen, daß der Hochspringer, der auf der Erde 2 m schafft, die Latte auf dem Mond auf 12 m legen läßt. Tatsächlich darf man aber nicht rechnen, wie weit der Hochspringer seine Füße anhebt, sondern wie hoch er seinen Gesamtschwerpunkt hebt. Zwar müssen die Füße vom Boden über die Latte und werden daher um 2 m gehoben, aber der Kopf befindet sich schon knapp unter der Latte und muß kaum noch gehoben werden. Daher muß man zunächst fragen, wie hoch der Hochspringer den Körper durchschnittlich heben muß, weil ja schon bei ruhig stehendem Hochspringer einige Körperteile mehr und andere weniger Höhe über dem Boden haben. Als durchschnittliche Körperhöhe läßt sich in diesem Fall die Höhe des Körperschwerpunktes heranziehen.
Nimmt man der Einfachheit halber an, daß der Schwerpunkt des Hochspringers in 1 m Höhe liegt, dann hebt er ihn zum Sprung um einen weiteren Meter an, um über die Latte zu kommen. Auf dem Mond würde das bedeuten, daß er mit der gleichen Sprungkraft seinen Schwerpunkt um 6 statt einen Meter heben kann und da sich der Schwerpunkt bereits einen Meter über dem Mondboden befindet, wäre also eine Sprunghöhe von 7 m zu erwarten. Mit der Annahme, daß der Schwerpunkt eines springenden Kämpfers auf der Erde bereits 1 m Höhe hat, bedeutet das, daß er seine Sprungkraft verdoppeln muß, wenn er 3 statt 2 Meter hoch springen will.
Wer höher oder weiter hinaus will, braucht einen Energiespeicher, z.B. ein Trampolin, bei dem er sich mit mehreren Sprüngen an die gewünschte Sprunghöhe heranarbeiten kann. Bei jedem Sprung führt er seinem Körper wieder ein bißchen Energie zu, die beim Herunterfallen vom Trampolin aufgenommen und beim nächsten Sprung wieder nahezu vollständig zurückgegeben wird. Känguruh, die in früheren Zeiten als Boxer auf Jahrmärkten herhalten mußten, besitzen dazu eine Sehne, die ihre Sprungenergie wie eine Feder speichert und sie weite Strecken ermüdungsarm springen läßt.
|
Wenn man den Sandsack schlägt, nimmt er Energie auf. Einen Teil dieser
Energie verbraucht die Füllung, in dem sie sich verformt
(Formänderungsarbeit) und die Energie dann in Wärme umsetzt, z.B.
durch Sand- oder Maiskörner, die sich gegeneinander verschieben und
dabei aneinander reiben. Ein anderer Teil wird in kinetische Energie (also
Bewegung des Sandsackes) umgesetzt. Dadurch pendelt der Sandsack (vom Angreifer
gesehen) nach hinten weg. Dabei hebt sich der Sandsack und sein Schwerpunkt
so lange, bis die kinetische Energie aufgezehrt ist. Man nennt die in der
Höhe gespeicherte Energie potentielle Energie oder Lageenergie. Der
Augenblick, in dem der Sandsack umkehrt, hat er keine kinetische Energie
(die Geschwindigkeit ist Null), sondern nur noch potentielle Energie, aber
er kann so nicht in der Luft stehen bleiben, sondern pendelt zurück.
Hier einige Rezepte, um das Pendeln zu mindern: Das einfachste wäre
es natürlich, den Sandsack an einer Wand festzunageln (man nennt ihn
dann Wandsack). Wer aber die Bewegungsfreiheit an einem frei hängenden
Sack liebt, der kann mit folgenden Maßnahmen das Pendeln reduzieren:
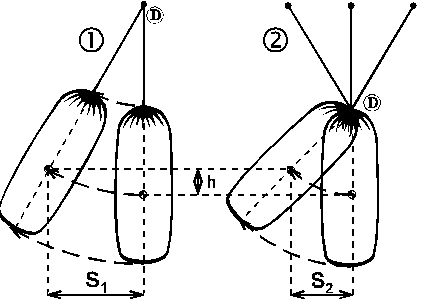
Die obere Grafik zeigt zwei Aufhängungen, bei denen man den Sandsack als Pendel betrachten kann. Über die Länge zwischen Schwerpunkt und Drehpunkt (D) kann man die Schwingzeit und die Schwingweite (Amplitude) einstellen. Bei (1) liegt der Drehpunkt (D) an der Decke. Der Sandsack schwingt weit zurück (s1) und braucht hier sehr lange, bis er zurückkehrt. Bei (2) kehrt der Sandsack schneller zurück und hat einen kürzeren Weg (s2). Die Aufhängung in (2) besteht aus drei Seilen, die ein räumliches Dreibein bilden, gewissermaßen ein Stativ, welches an der Decke hängt und statt einer Kamera den Sandsack trägt. Üblicherweise besitzen Sandsäcke angenähte Laschen, die durch Ketten mit einem Ring verbunden sind, an welchem wiederum der Sandsack hängt. Aufhängung (1) und (2) sind so gezeichnet, als hätten die Sandsäcke jeweils den gleichen Schlag erhalten, denn die Schwerpunkte haben beim Pendeln die gleichen maximalen Höhen erreicht. Man könnte nun auf die Idee kommen, für die Aufhängung (2) die Ketten wegzulassen und die gezeigten Seile gleich mit den Laschen zu verbinden. Dies reduziert zwar die Pendelneigung weiter, führt aber zu einer erheblich höheren Belastung der einzelnen Lasche, weil die Kräfte nicht mehr auf alle Laschen gleichmäßig übertragen werden.
Die beiden Grafiken von den einzelnen Sandsäcken zeigen, wie die Aufhängungen (1) und (2) pendeln.
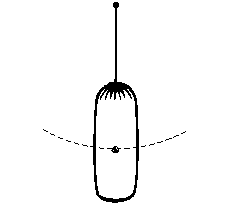 |
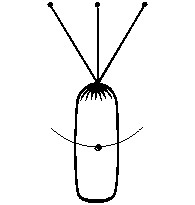 |
Läßt man eines der drei Seile in (2) weg, kann man den Sandsack so aufhängen, daß er in der einen Richtung wie in (1) weit pendelt und senkrecht dazu wie in (2) kurz pendelt. Wenn der Sandsack gleichmäßig gefüllt ist (also mit einer Füllung konstanter Dichte), dann hat die Masse (das Gewicht) des Sandsackes keinen Einfluß auf die Schwingzeit.
Aus der Praxis eines erfolgreichen Wettkämpfers (Michael Wedel, s. u.) stammt folgende Empfehlung: Einen langen Sandsack fülle man im unteren Teil mit Sand, damit die Schienbeine durch das Low-Kick-Training abgehärtet werden. Darüber hinaus soll der Sandsack etwa das Gewicht des eigenen Körpers haben, um im Training die richtige Kraft für den Kampf mit einem gleich schweren Gegner (ergibt sich durch die Gewichtsklassen im Wettkampfsport) zu entwickeln.
|
Eigentlich existiert der Schwerpunkt gar nicht. Aber Techniker arbeiten gerne mit dem Schwerpunkt, da sich viele Überlegungen ganz einfach nachvollziehen lassen, wenn man annimmt, daß die Masse eines Körpers in einem Punkt konzentriert sei. Es gibt einige Eigenschaften, die sich mit dem Schwerpunkt einfach erklären lassen, z. B.:
Der Schwerpunkt muß nicht immer innerhalb eines Körpers liegen. Beim Fußball liegt er genau in der Mitte der hohlen Lederkugel.
Häufig wird der Schwerpunkt des Menschen im Bauchbereich vermutet. Dies ändert sich jedoch ständig mit der Körperhaltung. Betrachtet man einen Hochspringer beim Fosbury-Flop, so bemerkt man außergewöhnliches: Mit dem Ziel vor Augen, immer höher zu springen, versucht der Athlet, die Grenzen seiner Sprungkraft dadurch zu überwinden, daß er seinen Schwerpunkt gar nicht über die Latte wuchtet. Statt dessen bleibt der Schwerpunkt des Hochspringers bis zu 9 cm unter der Latte (so hoch, wie ihn der Athlet gerade heben kann). Der Hochspringer windet durch geschickte Verformung seines Körpers nur dessen einzelne Teile über die Latte. Dabei gleicht die Lage des Körperschwerpunktes dem einer Salatschüssel: Ihr Schwerpunkt liegt in ihrem Inneren, also da, wo überhaupt kein Material ist.